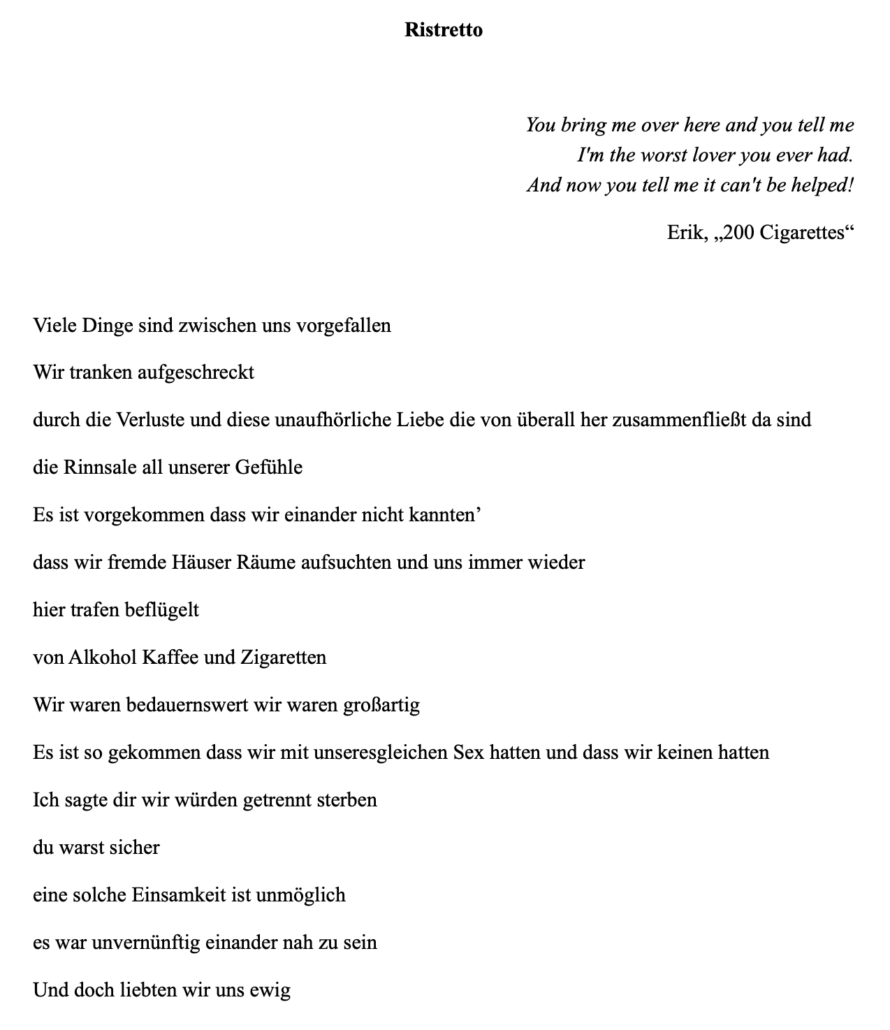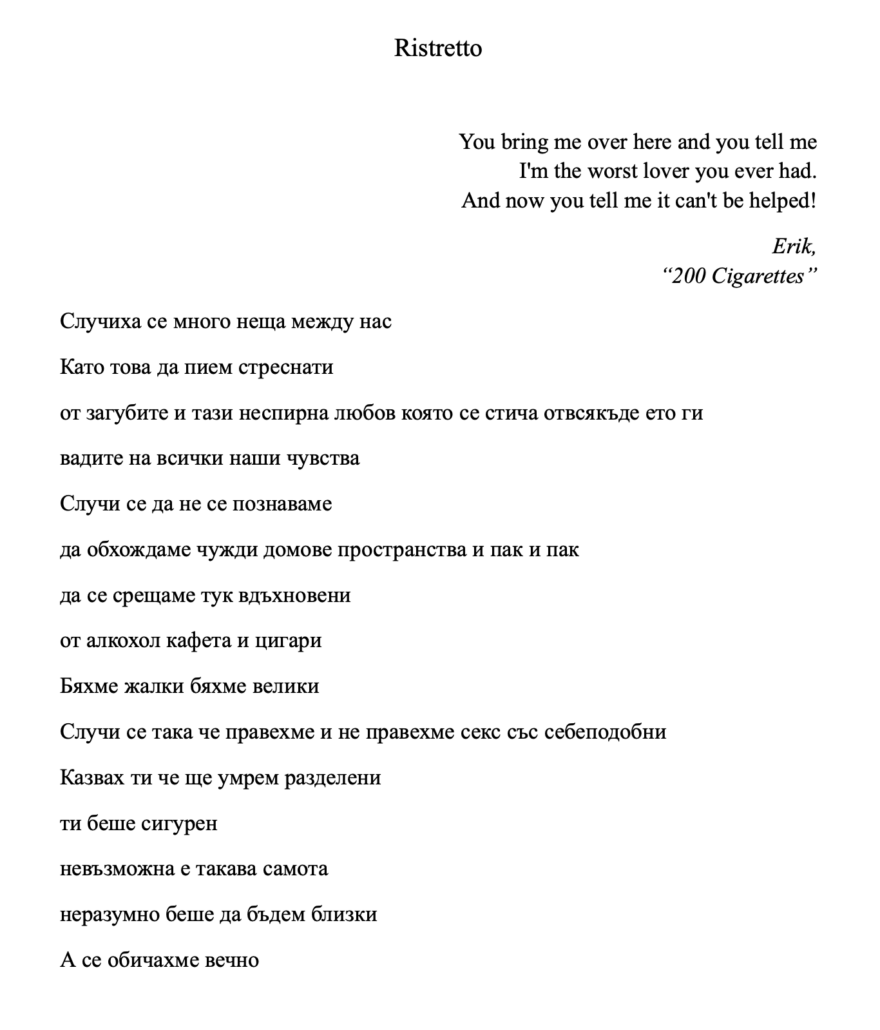Pascal Dessaint | L’Évasion Bar, Toulouse
Foto: Alain Barbero | Text: Pascal Dessaint | Übersetzung aus dem Französischen: Daniela Gerlach
Wenn man vernünftig ist
überquert man nicht die Strasse
um der Unbekannten zu sagen dass sie einen verwirrt
Wenn man vernünftig ist
nimmt man nicht den Weg
der zu der unbeachteten Schönheit führt
Wenn man vernünftig ist
begibt man sich niemals aus reinem Vergnügen
in die Gefahr zu fallen
Wenn man vernünftig ist
hat man niemals Träume die sich nicht erfüllen könnten
und das ist schade
Wenn man vernünftig ist
hat man nie die Wahrheit vor Augen
ein magisches Gefühl ein rotes Kleid
Kurzinterview mit dem Autor
Was kann oder soll Literatur?
Pascal Dessaint: Sie soll vor allem Freude bereiten. In dem Moment aber, wenn sie von der Welt zeugt, scheint sie mir auch eine essentielle Funktion zu erfüllen. Bezeugen, und vielleicht auch manchmal sich empören, warnen!
Welche Bedeutung haben Cafés für dich?
PD: Cafés sind der Rahmen für viele Szenen in meinen Romanen. Manchmal hänge ich da ab, um den Puls der Zeit zu fühlen, in der Hoffnung, jemanden zu finden, der mich inspiriert. Es ist schon oft passiert, dass ich einem meiner zukünftigen Charaktere begegnet bin …
Wo fühlst du dich zu Hause?
PD: Momentan, oft weit weg von den Menschen! Ich versuche, so oft wie möglich dem Gelärme der Zivilisation zu entkommen, und das wird immer schwieriger. Ein Berg, ein Wald, eine Heidelandschaft … Da, wo ich meine Zerbrechlichkeit spüre, und wie relativ meine Wichtigkeit ist.
BIO
Pascal Dessaint wurde in Dunkerque geboren. Er lebt in Toulouse. Seine Romane wurden mit dem Grand Prix de la littérature policière (Großer Preis für Krimi-Literatur), dem Prix Mystère de la Critique und dem Jean-Amila Meckert-Preis ausgezeichnet. 1999 erschien „Du bruit sous le silence“, der erste Krimi, der in der Welt des Rugby spielt. Seit „Mourir n’est peut-être pas la pire des choses“, 2003, geht es in vielen seiner Bücher um die misshandelte Natur. In „Loin des humains“, 2005, beschwört er die Katastrophe im Chemiewerk AZF in Toulouse herauf und den Metaleurop-Skandal in „Les derniers jours d’un homme“, 2010. Unter seinem Werk befinden sich auch persönlichere Schriften sowie Chroniken und Streifzüge „Vertes et Vagabondes“.
Bücher, die auf Deutsch erschienen sind: „Schlangenbrut“ (DistelLiteratur, 2005), „Verlorener Horizont“ (Polar Verlag, 2021).
www.pascaldessaint.fr
Facebook Page Officielle